Hirnforschung – Tanzen macht schlau
November 22, 2009
 Hirnforscher haben Tänzern in den Kopf geschaut und festgestellt: Sie trainieren wichtige Fähigkeiten und senken ihr Demenzrisiko.
Hirnforscher haben Tänzern in den Kopf geschaut und festgestellt: Sie trainieren wichtige Fähigkeiten und senken ihr Demenzrisiko.
WAS SOLL EIN TANZKURS denn bringen? An dieser Frage sind schon viele Frauen gescheitert, die versucht haben, aus einer Couchpotato einen Parkettlöwen zu machen. Jetzt liefert ihnen die Wissenschaft bestechende Argumente. Die Hirnforscher Steven Brown von der Simon Fraser University im kanadischen Burnaby und Michael Martinez von der University of Texas in San Antonio untersuchten erstmals, welche Gehirnregionen beim Tanzen aktiv sind. Dazu legten Brown und Martinez nacheinander fünf weibliche und fünf männliche Amateur-Tangotänzer in den Kernspintomographen und befestigten eine Platte so am Fußende, dass die Füße der Tänzer darüber gleiten und einfache Tangoschritte ausführen konnten. Über Kopfhörer wurde Musik eingespielt. Im ersten Durchgang sollten die Probanden zur Musik Tangoschritte auf der Platte machen, im zweiten Durchgang willkürlich ihre Beine bewegen.
Wie die Forscher erwarteten, waren in beiden Durchgängen die motorischen Gehirnregionen der Probanden aktiv. Doch beim Tango feuerten die Neuronen auch noch an einer anderen Stelle stark: im „Precuneus“. Diese Hirnregion im Scheitellappen ist wichtig für Orientierung und Raumsinn. Sensoren in Muskeln und Gelenken übermitteln Informationen dorthin. Deshalb sprechen die Wissenschaftler auch vom Bewegungssinn. Mit seiner Hilfe nimmt der Mensch Bewegungen und Gelenkpositionen wahr. „Der Precuneus ist eine Art kinästhetische Landkarte, die es dem Menschen erlaubt, seinen Körper im Raum zu navigieren“, erklärt Brown. Beim Tanzen, schließt der Hirnforscher, ist diese Raumwahrnehmung offenbar besonders ausgeprägt.
Wie die Wissenschaftler schon länger wissen, ist das kinästhetische Sinnessystem stark mit anderen Hirnfunktionen wie Gedächtnis, Sprache, Lernen und Emotionen verknüpft. „Bewegung beschleunigt das Gehirn zu maximaler Leistung“, deutet Siegfried Lehrl, Psychologe an der Uni versität Erlangen und Experte für Gehirnjogging, die neuen Befunde. Die Tangotänzer-Studie deckte auch auf, warum rhythmische Musik viele Menschen dazu bringt, mitzuklatschen, zu schnipsen oder mit Kopf oder Fuß zu wippen. Voraussetzung dafür ist, dass das Gehirn Rhythmen erkennt, vergleicht und in Beziehung zu gespeichertem Wissen setzt. Das heißt, je bekannter ein Rhythmus ist, desto stärker wird die Bewegung provoziert.
Steven Brown stellte fest, dass beim Tanzen mit Musik der sogenannte Kleinhirnwurm aktiver ist, als wenn die musikalische Untermalung fehlt. „Diese Hirnregion fungiert als eine Art neuronaler Taktgeber und ist mit den auditorischen, visuellen und somatosensorischen Systemen im Gehirn verbunden“, erklärt Brown. Auch das aus evolutionsbiologischer Sicht sehr alte sogenannte vestibuläre System in Innenohr und Kleinhirn, das den Gleichgewichtssinn steuert, ist notwendig für die Verbindung von Bewegung und Rhythmus. Das unterstützt die gängige These, dass Tanzen und Musizieren in der Menschheitsgeschichte zur gleichen Zeit entstanden sind. Zum Tanzen braucht der Mensch ähnlich komplexe sensomotorische Fähigkeiten wie zum Erlernen eines Musikinstruments.
Doch das Tanzen hat für die Entwicklung des Menschen noch eine weit größere Bedeutung als das Musizieren: Es trainiert die Fähigkeit zum Nachahmen. Die Forscher fanden heraus: Wenn man sich nur vorstellt, Walzer zu tanzen, arbeitet das Gehirn in den gleichen Regionen, wie wenn man tatsächlich Walzer tanzt. Beim Tanzen nur zuzuschauen genügt schon, um die entsprechenden Hirnregionen zu aktivieren – um zwar umso stärker, je bekannter der Tanz ist. „Wir schließen daraus, dass Tanzen früher eine Form der Kommunikation war“, erklärt Steven Brown – und liefert Belege: Bei allen untersuchten Bewegungsabläufen war bei den Tangotänzern eine Region in der rechten Gehirnhälfte aktiv, die der Broca-Region in der linken Hemisphäre als sogenanntes Homolog entspricht.
Quelle: wissenschaft.de
Graue Zellen wachsen auch bei Senioren nach! – Lernen und Jonglieren: Bodybuilding fürs Gehirn
November 22, 2009
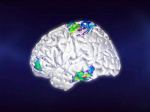 Dogma der Hirnforschung wankt
Dogma der Hirnforschung wankt
Bis vor etwa zehn Jahren galt es in der Hirnforschung als unumstößliche Gewissheit, dass das Gehirn nach der Pubertät nur noch abbaut und nicht mehr wachsen kann. Was durch Alter oder Krankheit an grauer Hirnsubstanz verschwindet, ist unwiderruflich verloren, glaubte man. Doch seit Mitte der 1990er Jahre müssen Ärzte und Wissenschaftler umdenken – nicht zuletzt durch neue bildgebende Verfahren in den Neurowissenschaften. Berühmt geworden ist vor allem eine 1997 publizierte Studie an Londoner Taxifahren. Sie belegte, dass bei ihnen der hintere Teil des Hippokampus stark vergrößert war – einer Hirnregion, die unter anderem für das räumliche Orientierungsvermögen zuständig ist. Auch bei anderen hochspezialisierten Berufsgruppen wie Musikern und Schachspielern zeigte sich, dass bei ihnen bestimmte Areale des Hirns deutlich vergrößert waren. Doch waren sie nun Taxifahrer, Schachspieler oder Musiker geworden, weil ihre Hirne anders sind als bei anderen? Oder hatten sich die graue Masse wegen ihrer Tätigkeit und der langjährigen Übung so entwickelt?
Jonglieren: Hochleistungssport für’s Gehirn
Eine Studie der Universitäten in Regensburg und Jena unter der Leitung von Arne May sollte diese Frage endgültig klären. Drei Monate jonglierten junge Erwachsene (Durchschnittsalter 22 Jahre) mindestens eine Minute täglich mit drei Bällen. Die Jonglier-Neulinge sollten die Bälle mindestens 60 Sekunden in der Luft halten – eine enorme Herausforderung für visuelle Wahrnehmung, räumliches Vorstellungsvermögen und Reaktions- und Koordinationsfähigkeit. Dreimal wurden die Hirne der Probanden im Kernspin-Tomografen untersucht: vor dem Training, nach dreimonatigem Üben, und dann wieder nach einer dreimonatigen Übungspause. Nach drei Monaten Training waren zwei Hirnareale der Amateur-Jongleure deutlich vergrößert – vor allem in solchen Bereichen, die für das visuelle Erfassen von Bewegungsabläufen zuständig sind. Dagegen waren diese Areale nach der Trainingspause wieder auf ihr altes Maß geschrumpft.
Neue Hirnzellen für ergraute Köpfe
Dass sich auch bei Erwachsenen das Hirn durch Lernen noch anatomisch verändern kann, war damit bewiesen – eine wissenschaftliche Sensation: Erstmals war das jahrzehntealte Dogma von der Unveränderlichkeit des erwachsenen Gehirns widerlegt. Nun wollten die Forscher wissen, ob die grauen Zellen in jedem Alter nachwachsen – macht es einen Unterschied, ob die Versuchspersonen 22 oder 62 Jahre alt sind? Eine Folgestudie am Institut für Systemische Neurowissenschaften am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf wiederholt das Experiment im Winter 2006 mit einer älteren Gruppe. 40 Probanden ab Mitte 50 unterziehen sich hier dem Jonglier-Training. Noch ist die Studie nicht abgeschlossen, aber erste Ergebnisse liegen vor – und sie sind spektakulär: Selbst 60jährige Jonglier-Novizen können die Kunst mit den drei Bällen in drei Monaten erlernen. Zwar deutlich langsamer und nicht ganz so gut wie die Zwanzigjährigen aus dem Regensburger Versuch. Die schafften es doppelt so häufig wie ihre älteren Kollegen, die Bälle eine Minute in der Luft zu halten. Dafür scheinen die ersten Analysen in Hamburg aber zu bestätigen, dass auch bei Älteren das Gehirn tatsächlich noch wächst! Mit anderen Worten: Auch bei ihnen vermehrt sich die graue Substanz. Beim körperlichen Training werden die Gehirne der Senioren in den entsprechenden Bereichen größer. Allerdings wissen die Forscher nicht, was da genau wächst – es könnte die Zahl der Hirnzellen selbst oder die Anzahl der Verbindungen zwischen den Zellen sein. Die derzeit gängigen Untersuchungsverfahren können das nicht unterscheiden.
(Das bedeutet ja nicht, dass nun jeder mit dem Jonglieren beginnen müsste, um das Gehirn zu stärken. Es zeigt sich hier aber erneut, das es viele Beschäftigungen gibt, die dem Gehirn sehr gut tun, und sogar noch Freude machen können, wie z.B. ein Tanzkurs, Kreuzworträtseln, aber auch Spazieren und Jonglieren. Nach Meinung vieler Wissenschaflter kann diese Erkenntnis genutzt werden, um neurologische Erkrankungen wie Multiple Sklerose zu behandeln.)
Quelle, Text und Bild: wdr.de