Hirnforschung – Tanzen macht schlau
November 22, 2009
 Hirnforscher haben Tänzern in den Kopf geschaut und festgestellt: Sie trainieren wichtige Fähigkeiten und senken ihr Demenzrisiko.
Hirnforscher haben Tänzern in den Kopf geschaut und festgestellt: Sie trainieren wichtige Fähigkeiten und senken ihr Demenzrisiko.
WAS SOLL EIN TANZKURS denn bringen? An dieser Frage sind schon viele Frauen gescheitert, die versucht haben, aus einer Couchpotato einen Parkettlöwen zu machen. Jetzt liefert ihnen die Wissenschaft bestechende Argumente. Die Hirnforscher Steven Brown von der Simon Fraser University im kanadischen Burnaby und Michael Martinez von der University of Texas in San Antonio untersuchten erstmals, welche Gehirnregionen beim Tanzen aktiv sind. Dazu legten Brown und Martinez nacheinander fünf weibliche und fünf männliche Amateur-Tangotänzer in den Kernspintomographen und befestigten eine Platte so am Fußende, dass die Füße der Tänzer darüber gleiten und einfache Tangoschritte ausführen konnten. Über Kopfhörer wurde Musik eingespielt. Im ersten Durchgang sollten die Probanden zur Musik Tangoschritte auf der Platte machen, im zweiten Durchgang willkürlich ihre Beine bewegen.
Wie die Forscher erwarteten, waren in beiden Durchgängen die motorischen Gehirnregionen der Probanden aktiv. Doch beim Tango feuerten die Neuronen auch noch an einer anderen Stelle stark: im „Precuneus“. Diese Hirnregion im Scheitellappen ist wichtig für Orientierung und Raumsinn. Sensoren in Muskeln und Gelenken übermitteln Informationen dorthin. Deshalb sprechen die Wissenschaftler auch vom Bewegungssinn. Mit seiner Hilfe nimmt der Mensch Bewegungen und Gelenkpositionen wahr. „Der Precuneus ist eine Art kinästhetische Landkarte, die es dem Menschen erlaubt, seinen Körper im Raum zu navigieren“, erklärt Brown. Beim Tanzen, schließt der Hirnforscher, ist diese Raumwahrnehmung offenbar besonders ausgeprägt.
Wie die Wissenschaftler schon länger wissen, ist das kinästhetische Sinnessystem stark mit anderen Hirnfunktionen wie Gedächtnis, Sprache, Lernen und Emotionen verknüpft. „Bewegung beschleunigt das Gehirn zu maximaler Leistung“, deutet Siegfried Lehrl, Psychologe an der Uni versität Erlangen und Experte für Gehirnjogging, die neuen Befunde. Die Tangotänzer-Studie deckte auch auf, warum rhythmische Musik viele Menschen dazu bringt, mitzuklatschen, zu schnipsen oder mit Kopf oder Fuß zu wippen. Voraussetzung dafür ist, dass das Gehirn Rhythmen erkennt, vergleicht und in Beziehung zu gespeichertem Wissen setzt. Das heißt, je bekannter ein Rhythmus ist, desto stärker wird die Bewegung provoziert.
Steven Brown stellte fest, dass beim Tanzen mit Musik der sogenannte Kleinhirnwurm aktiver ist, als wenn die musikalische Untermalung fehlt. „Diese Hirnregion fungiert als eine Art neuronaler Taktgeber und ist mit den auditorischen, visuellen und somatosensorischen Systemen im Gehirn verbunden“, erklärt Brown. Auch das aus evolutionsbiologischer Sicht sehr alte sogenannte vestibuläre System in Innenohr und Kleinhirn, das den Gleichgewichtssinn steuert, ist notwendig für die Verbindung von Bewegung und Rhythmus. Das unterstützt die gängige These, dass Tanzen und Musizieren in der Menschheitsgeschichte zur gleichen Zeit entstanden sind. Zum Tanzen braucht der Mensch ähnlich komplexe sensomotorische Fähigkeiten wie zum Erlernen eines Musikinstruments.
Doch das Tanzen hat für die Entwicklung des Menschen noch eine weit größere Bedeutung als das Musizieren: Es trainiert die Fähigkeit zum Nachahmen. Die Forscher fanden heraus: Wenn man sich nur vorstellt, Walzer zu tanzen, arbeitet das Gehirn in den gleichen Regionen, wie wenn man tatsächlich Walzer tanzt. Beim Tanzen nur zuzuschauen genügt schon, um die entsprechenden Hirnregionen zu aktivieren – um zwar umso stärker, je bekannter der Tanz ist. „Wir schließen daraus, dass Tanzen früher eine Form der Kommunikation war“, erklärt Steven Brown – und liefert Belege: Bei allen untersuchten Bewegungsabläufen war bei den Tangotänzern eine Region in der rechten Gehirnhälfte aktiv, die der Broca-Region in der linken Hemisphäre als sogenanntes Homolog entspricht.
Quelle: wissenschaft.de
Graue Zellen wachsen auch bei Senioren nach! – Lernen und Jonglieren: Bodybuilding fürs Gehirn
November 22, 2009
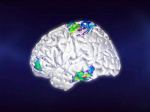 Dogma der Hirnforschung wankt
Dogma der Hirnforschung wankt
Bis vor etwa zehn Jahren galt es in der Hirnforschung als unumstößliche Gewissheit, dass das Gehirn nach der Pubertät nur noch abbaut und nicht mehr wachsen kann. Was durch Alter oder Krankheit an grauer Hirnsubstanz verschwindet, ist unwiderruflich verloren, glaubte man. Doch seit Mitte der 1990er Jahre müssen Ärzte und Wissenschaftler umdenken – nicht zuletzt durch neue bildgebende Verfahren in den Neurowissenschaften. Berühmt geworden ist vor allem eine 1997 publizierte Studie an Londoner Taxifahren. Sie belegte, dass bei ihnen der hintere Teil des Hippokampus stark vergrößert war – einer Hirnregion, die unter anderem für das räumliche Orientierungsvermögen zuständig ist. Auch bei anderen hochspezialisierten Berufsgruppen wie Musikern und Schachspielern zeigte sich, dass bei ihnen bestimmte Areale des Hirns deutlich vergrößert waren. Doch waren sie nun Taxifahrer, Schachspieler oder Musiker geworden, weil ihre Hirne anders sind als bei anderen? Oder hatten sich die graue Masse wegen ihrer Tätigkeit und der langjährigen Übung so entwickelt?
Jonglieren: Hochleistungssport für’s Gehirn
Eine Studie der Universitäten in Regensburg und Jena unter der Leitung von Arne May sollte diese Frage endgültig klären. Drei Monate jonglierten junge Erwachsene (Durchschnittsalter 22 Jahre) mindestens eine Minute täglich mit drei Bällen. Die Jonglier-Neulinge sollten die Bälle mindestens 60 Sekunden in der Luft halten – eine enorme Herausforderung für visuelle Wahrnehmung, räumliches Vorstellungsvermögen und Reaktions- und Koordinationsfähigkeit. Dreimal wurden die Hirne der Probanden im Kernspin-Tomografen untersucht: vor dem Training, nach dreimonatigem Üben, und dann wieder nach einer dreimonatigen Übungspause. Nach drei Monaten Training waren zwei Hirnareale der Amateur-Jongleure deutlich vergrößert – vor allem in solchen Bereichen, die für das visuelle Erfassen von Bewegungsabläufen zuständig sind. Dagegen waren diese Areale nach der Trainingspause wieder auf ihr altes Maß geschrumpft.
Neue Hirnzellen für ergraute Köpfe
Dass sich auch bei Erwachsenen das Hirn durch Lernen noch anatomisch verändern kann, war damit bewiesen – eine wissenschaftliche Sensation: Erstmals war das jahrzehntealte Dogma von der Unveränderlichkeit des erwachsenen Gehirns widerlegt. Nun wollten die Forscher wissen, ob die grauen Zellen in jedem Alter nachwachsen – macht es einen Unterschied, ob die Versuchspersonen 22 oder 62 Jahre alt sind? Eine Folgestudie am Institut für Systemische Neurowissenschaften am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf wiederholt das Experiment im Winter 2006 mit einer älteren Gruppe. 40 Probanden ab Mitte 50 unterziehen sich hier dem Jonglier-Training. Noch ist die Studie nicht abgeschlossen, aber erste Ergebnisse liegen vor – und sie sind spektakulär: Selbst 60jährige Jonglier-Novizen können die Kunst mit den drei Bällen in drei Monaten erlernen. Zwar deutlich langsamer und nicht ganz so gut wie die Zwanzigjährigen aus dem Regensburger Versuch. Die schafften es doppelt so häufig wie ihre älteren Kollegen, die Bälle eine Minute in der Luft zu halten. Dafür scheinen die ersten Analysen in Hamburg aber zu bestätigen, dass auch bei Älteren das Gehirn tatsächlich noch wächst! Mit anderen Worten: Auch bei ihnen vermehrt sich die graue Substanz. Beim körperlichen Training werden die Gehirne der Senioren in den entsprechenden Bereichen größer. Allerdings wissen die Forscher nicht, was da genau wächst – es könnte die Zahl der Hirnzellen selbst oder die Anzahl der Verbindungen zwischen den Zellen sein. Die derzeit gängigen Untersuchungsverfahren können das nicht unterscheiden.
(Das bedeutet ja nicht, dass nun jeder mit dem Jonglieren beginnen müsste, um das Gehirn zu stärken. Es zeigt sich hier aber erneut, das es viele Beschäftigungen gibt, die dem Gehirn sehr gut tun, und sogar noch Freude machen können, wie z.B. ein Tanzkurs, Kreuzworträtseln, aber auch Spazieren und Jonglieren. Nach Meinung vieler Wissenschaflter kann diese Erkenntnis genutzt werden, um neurologische Erkrankungen wie Multiple Sklerose zu behandeln.)
Quelle, Text und Bild: wdr.de
Interview mit Gunter Ewald, Mathematiker, Philosoph
November 21, 2009
Die Quantenphysik beamt die Vorstellungskraft der Menschen in unendliche Weiten. Sie eröffnet eine Mikroperspektive in Dimensionen, in der die Materie sich aufl öst – die Domäne mathematischer Höchstleistungen und ein Eldorado für spirituelle Denker, die von hier aus Brücken zu spirituellen Sphären schlagen. Andere Forschungsergebnisse geben dem Menschen dafür umso mehr Bodenhaftung. Durchleuchtet von verschiedenen Disziplinen, verwandelt sich der Homo Sapiens in eine Biomaschine, ausgestattet mit komplexem Programm. Aber das entzieht sich weitgehend seiner Kontrolle. Soziologisch determiniert, biochemisch fixiert, gehirntechnisch lokalisiert bleibt ihm nur ein kleiner Rest, um kreativ sein Leben zu gestalten. Der entscheidende? Gespräch mit einem interdisziplinären Forscher über menschliches Vorstellungsvermögen, die Macht der Prägung und die Freiheit des Willens.
PB: Die meisten von uns haben als Schulwissen über das Innenleben der Elemente noch das Bohrsche Atommodell abgespeichert: Elektronen, die um einen festen Kern kreisen. Das erschien irgendwie noch greifbar, ist aber nur eine Vorstufe. Die Quantenphysik dringt noch viel tiefer in den Mikrokosmos vor. Wie kann man sich diese Größenverhältnisse, beispielsweise in einem Bild gedacht, noch zugänglich machen?
Ewald: Als Annäherung ist es brauchbar, wenn man von dem Atommodell ausgeht, das in vergröbernder Vorstellung wie ein Planetensystem aufgebaut ist. Aber nehme ich diese Planeten bzw. Elektronen oder die Sonne, also den Kern, immer weiter unter die Lupe, verschwimmt das Bild plötzlich. Das Atommodell ist nicht falsch, sondern es ist noch zu grob, um die Feinstruktur der Materie zu erklären. Die Quantenphysik reicht in andere Größenbereiche hinein, in Miniaturbereiche, denen gegenüber sich die Atome wie Planetensysteme gegenüber diesem Zimmer verhalten.
PB: Als allerkleinstes Teilchen wurde das so genannte Partikel entdeckt, das in sich nochmals solche Größendimensionen tragen soll. Löst sich die Materie auf, je genauer man sie betrachtet?
Ewald: Wenn man immer tiefer in ein Verständnis der Materie eindringt, muss man letztlich auch die Teilchenvorstellung aufgeben. „Teilchen“ ist nur ein Begriff aus unserer Sprache, um schon reichlich komplizierte Strukturen zusammenzufassen. Aber diese Teilchen sind nicht – wie man sie sich gerne vorstellt – banale Kügelchen, die man nicht mehr teilen kann und die selbst keine Eigenschaften haben. Sondern was wir Teilchen nennen, ist schon ein sehr schwer zu beschreibendes Schwingungsgebilde in einem energieerfüllten Raum.
PB: Können diese Partikel noch lokalisiert werden?
Ewald: Schon das Elektron kann man nicht mehr richtig lokalisieren. Wie die Physiker sagen: Es ist über seine Bahn verschmiert. Und selbst von dieser Bahn kann man nicht mehr genau sprechen – ohne sehr zu vergröbern. Wenn man das weitertreibt, kommt man an die Grenzen unserer Vorstellungskraft überhaupt. Wobei interessanterweise die Mathematik immer noch weiter vorstoßen kann. Sie fasst gut in ein System, was unsere Vorstellung nicht mehr zu fassen vermag.
PB: Spiegelt sich das, was wir unter mathematischer Logik verstehen, denn auch tatsächlich in den bisher erforschten Naturgesetzen?
Ewald: Ja. Die logische Deduktion, also angewandte Logik, schlägt sich in den mathematischen Formeln in der Naturwissenschaft nieder. Und es ist eines der größten Rätsel in der Naturwissenschaft, dass dasjenige, was man auf dem Weg der logischen Ableitung fi ndet, in den Naturprozessen so oft seine Entsprechung hat. Hier besteht eine Übereinstimmung in den inneren Abläufen, als ob die Natur selbst eine Logik in sich hätte. Es ist einfach ein Wunder. Die Naturwissenschaftler können nur darüber staunen, wissen es aber nicht zu begründen.
PB: Wenn Materie laut Quantenphysik nur eine von vielen Realitäten ist, was sehen, fühlen, tasten wir dann ringsum?
Ewald: Die Schwierigkeit liegt darin, dass unser Betasten mit den Händen, unser Sehen mit den Augen, unser Hören schon auf materiellen Prozessen beruht, das heißt eigentlich schon die Grobstruktur, die großen Gebilde des Materiellen benutzt. Um hinter dieses Grobe zu kommen, muss man sein Denken erweitern, nicht nur die Messinstrumente. Ein bisschen kann man verstehen, wenn man eine glatt polierte Oberfläche unter einem Mikroskop betrachtet und die Vergrößerung immer stärker einstellt. Dann wird aus dieser spiegelglatten Oberfläche plötzlich ein völlig unglattes Gebilde, ein Gebirge. Wenn ich dann noch weiter vergrößere, merke ich, dass da Atome schwingen. In dem, was ich ursprünglich als glatte Fläche oder Wand betrachtet habe, herrscht also ein chaotisches Spiel. Scheinbar. Und die Quantenphysik dringt noch tiefer vor. Und dabei müssen wir noch mehr Vorstellungen aufgeben als die einer glatten Oberfläche.
PB: Welche beispielsweise? Dass es eigentlich gar keine Materie gibt?
Ewald: Das Materielle ist mehr das, was man eigentlich Schwingung im Raum selbst nennen muss. Die Schwierigkeit besteht darin, dass wir uns normalerweise schon Materie denken, wenn wir Schwingung sagen. Sprich, wir stellen uns vor, wie die Luft oder das Wasser schwingen. Während hier umgekehrt die Materie erst damit erklärt werden soll, dass sie schwingt. Aber dann stellt sich die Frage, was da schwingt? Da sind die Physiker in Verlegenheit. Das können sie nicht beantworten. Man könnte höchstens sagen, der Raum hat die Fähigkeit zu schwingen.
PB: Dann ist er aber auch nicht vor allem leer, bzw. dann ist das Nichts auch nicht die größte, sich ausbreitende Sphäre, wie immer wieder postuliert wird?
Ewald: Der Raum ist nicht leer, sondern er ist voller Energie bzw. ein Feld, in dem Schwingungen möglich sind, und zwar sehr regelmäßig sich wiederholende Schwingungen. Sonst gäbe es gar nicht Begriffe wie Lichtteilchen, Elektron oder Positron. Das beruht auf der unglaublichen Regelmäßigkeit, auf die man in diesem scheinbaren Chaos stößt und die kaum noch zu verstehen ist, wenn man experimentell in die tiefen Bereiche des Mikroskopischen vordringt.
PB: Heißt das, im Chaos herrscht auch Ordnung?
Ewald: Ja, diese merkwürdige Verbindung aus Ordnung und Chaos ist eines der größten Wunder in der Natur.
PB: Und wirft die neue alte Frage auf: Woher kommt, wer schafft die Ordnung im Chaos?
Ewald: Wissenschaftlich gesehen, muss man das letztlich offen lassen. Vieles von der Ordnung im Chaos ist durch die Prinzipien der Biologie, der Psychologie, unseres Weltverständnisses insgesamt erklärbar – auch des wissenschaftlichen, aber letztlich ist es ein offenes Problem, was die Welt zusammenhält und was ihr eine Richtung gibt.
PB: Die ins Immaterielle reichende Quantenphysik fi ndet auch viel Nachhall, wenn es um die spirituelle Seite des Menschen geht. Auf Basis der These, dass alles aus den gleichen Partikeln geformt ist, werden spirituelle Themen wie Telepathie neu erforscht. Was denken Sie über die Möglichkeit dieses Phänomens?
Ewald: Telepathie, Hellsehen und Psychokinese müssen nicht unbedingt als spirituell angesehen werden; sie können – mindestens teilweise – Naturphänomene darstellen, die auch quantenphysikalisch nicht voll erfassbar sind. Zwar gilt ihre Existenz unter Naturwissenschaftlern als strittig, sie werden aber merkwürdigerweise praktisch genutzt. Beispielsweise hat die CIA zur Zeit des Kalten Krieges Millionen in die Einübung und Praktizierung von Hellsehen zu Spionagezwecken investiert, mit mäßigem Erfolg. Gott sei Dank; man hätte sonst ein Instrument gefunden, um so ziemlich alles auszuspionieren. Immerhin wurde das erste sowjetische Atom- U-Boot während seines Baus hellseherisch gesichtet – das Pentagon glaubte allerdings dem ungeheuerlichen Bericht nicht, bis das U-Boot vom Stapel lief und sich alles bestätigte. Paranormale Phänomene sind generell schwer systematisch zu fassen.
PB: Zu dem spirituellen Gedankengut rund um die Quantenphysik als „Physik der Möglichkeiten“ zählt auch: Das Feinstoffl iche, der Ursprung des Lebens sei entscheidend. Darum sei der Mensch im Grunde ein spirituelles Wesen und habe die damit verbundenen Möglichkeiten, z. B. die Kraft der Gedanken, längst nicht ausgeschöpft. Was denken Sie über solche Brückenschläge?
Ewald: Das „Feinstoffliche“ ist ein esoterischer Begriff und liegt der Quantenphysik fern. Ursprung des Lebens und Spiritualität des Menschen können ebenfalls nicht quantenphysikalisch erklärt werden. Aber quantenphysikalisches Denken öffnet einen Horizont, der über Physik hinausweist. Man kann damit rechnen, dass in absehbarer Zeit die – noch immer auf klassischer Physik basierende – Biologie ihre Grundlagen im Licht der Quantenphysik neu bedenken muss.
PB: Was heißt das insbesondere für Hirnbiologie und Neuroforschung? Viele Prozesse, die in den 100 Mrd. Nervenzellen des Gehirns ablaufen, legen, wie Sie schreiben, auch noch die Einbeziehung chaostheoretischer Methoden, insbesondere die Verwendung so genannter seltsamer oder chaotischer Attraktoren nahe. Was bedeutet das und wie hängt das mit Quantenphysik zusammen?
Ewald: Das fing so an: Ein Wetterforscher – Edward Lorenz – entwickelte unter vereinfachten Bedingungen eine mathematische Verlaufskurve für die Wetterentwicklung und stellte überrascht fest, dass die Kurve im zeitlichen Verlauf zwischen zwei Wetterzuständen hin und her pendelte. Eine Wettervorhersage war demnach auch theoretisch nicht möglich, von der Zahl der Messdaten ganz abgesehen. Ähnliche Verlaufskurven gibt es bei vielen Naturprozessen, insbesondere Hirnvorgängen. Streben sie mehreren oder gar unendlich vielen Zielpunkten zu, so nennt man die Gesamtheit dieser „Anziehungspunkte“ (Attraktoren) einen chaotischen Attraktor. Ein winzig kleiner Anstoß kann entscheiden, welcher Zustand – z. B. welches Wetter – wirklich eintritt. In der Hirnbiologie stößt man mit der hohen Empfindlichkeit gegenüber Einflüssen in Quantenbereiche vor – ein noch kaum erforschtes, wegen der großen Zahl chaotischer Attraktoren aber hoch relevantes Phänomen. Möglicherweise gibt es hier auch einen Ansatzpunkt für Einflüsse, die nicht einmal quantenphysikalisch fassbar sind.
PB: Trotz seines kosmischen Innenlebens soll das Gehirn nach der Kindheit vorrangig auf Musterbestätigung aus sein. Wie kreativ, wie veränderungsfähig ist es?
Ewald: In der Psychologie hat man mittlerweile mit lange herrschenden Vorstellungen gebrochen. Früher nahm man an, dass die Bahnungen im Gehirn, sozusagen die Art der Bahn, bereits in der Kindheit festgelegt werden und sich bei älteren Menschen nicht mehr verändern würden. In den letzten Jahren hat man herausgefunden, dass diese Annahme schlicht nicht stimmt, stattdessen verändert der Mensch die Bahnungen in seinem Gehirn lebenslang. Das bedeutet zudem, dass er immer wieder neue Prägungen erlebt, wenn auch weniger auffällig und intensiv als bei Kindern. Hier zeigt sich die Offenheit und Möglichkeit, in Neues vorzudringen. Das gehört zum Interessantesten und Schönsten beim Menschen. Ich bin ja nicht mehr sehr jung, aber ich lerne heute noch gerne Gedichte auswendig und finde das ein sehr schönes Erlebnis.
Quelle: promobizz.de
Interview mit Prof. Dr. Günter Ewald: Ist unser Gehirn ein Empfänger für Bewusstsein außerhalb seiner selbst?
November 21, 2009
psychophysik.com:
Herr Prof. Ewald, Sie haben 2006 zwei Bücher publiziert, welche sich mit der Natur von Geist und Materie beschäftigen. In Ihrem Buch „Nahtoderfahrungen“ haben Sie Hinweise auf ein Leben nach dem Tod untersucht. Und in Ihrem Buch „Gehirn, Seele und Computer“ machen Sie sich Gedanken darüber, inwiefern man Leben und Geist überhaupt hirnbiologisch verstehen kann. Sie haben ursprünglich Mathematik, Physik, Chemie und Philosophie studiert. Ihre Promotion und Habilitation erfolgte in Mathematik. Sie sind Mitbegründer des Sonderforschungsbereichs „Biologische Nachrichtenaufnahme und -Verarbeitung“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Im naturwissenschaftlichen Mainstream ist es bisher unüblich, sich mit Seele und Leben nach dem Tod zu beschäftigen. Was regt einen Mathematiker dazu an, sich mit diesen wissenschaftlichen Grenz- bereichen zu beschäftigen?Prof. Günter Ewald:
Der stark religiös (pietistisch) geprägte Hintergrund meiner Kindheit blieb im Studium bestehen und führte früh zur Auseinandersetzung zwischen Wissenschaft und Glauben. Als Mathematiker hat man wahrscheinlich mehr Freiheit, die oft unbemerkten Grundannahmen (Paradigmen) der Naturwissenschaften zu hinterfragen als etwa ein Paläontologe oder Biologe. Mich faszinierte fortschreitend die Erkenntnis, dass gerade kritisches Denken den Machtanspruch der Wissenschaft relativiert und einerseits dem Forschen selbst nutzt, andererseits weiter reichenden, wissenschaftlich nicht widerlegten oder widerlegbaren Überzeugungen Raum lässt. Zu letzteren zählen auch zeitgenössisch aufgearbeitete Vorstellungen von einer „unsterblichen Seele“. Nun gibt es gerade in den wissenschaftlichen Grenzbereichen immer wieder das Phänomen, dass sich die jeweiligen Protagonisten auf einem soliden Fundament harter Fakten wähnen, die Bedeutung der vielen kleinen und großen Grundannahmen jedoch vollkommen über- sehen. So schenken uns beispielsweise die modernen bildgebenden Verfahren die Möglichkeit, dem Gehirn erstmals bei der Arbeit zu- schauen zu können. Das riecht förmlich nach harten Fakten. Was aber lernen wir daraus genau … und was nicht? Ist menschlicher Geist das, was in unserem Gehirn eingesperrt ist?
Prof. Günter Ewald:
Die bildgebenden Verfahren sind eine große Bereicherung für die Hirnbiologie und lassen noch viele interessante Einsichten in das Geschehen unter der Schädeldecke erwarten. Sie liefern „harte Fakten“ wie die Verarbeitung von analogen oder digitalen Impulsen in einem Fernseher. Was aber der Inhalt eines Fernsehprogrammes ist, ergibt sich daraus nicht. Eines der gängigen „Paradigmen“ von Hirn- forschern ist, das Gehirn produziere selbst sein „Fernsehprogramm“, die Annahme, es sei „Empfangsstation“, gelte nur für sinnliche Wahrnehmung. „Geist“ wird dann in der Tat auf eine informationsver- arbeitende Maschinerie des Gehirns reduziert. Den Geist so „ins Gehirn einzusperren“ ist willkürlich und engt hirnbiologische Arbeit ein. Trotz großer Fortschritte ist unser Wissen über die hundert Milliarden Nervenzellen im Gehirn äußerst gering und reicht auch prinzipiell nicht aus, um den Begriff „Geist“ zu definieren. Man kann hoffen, dass die Hirnforschung – wie die Physik vor hundert Jahren – langsam aus ihrer im „main stream“ noch niedrig-materialistischen Denkweise herausfindet.
psychophysik.com:
Bleiben wir bei Ihrem Beispiel „Fernsehprogramm“. Tun wir also einmal so, als ob menschliches Bewusstsein – alles das, was wir bewusst sehen, fühlen, riechen, schmecken, hören, denken, erleben, wahr- nehmen – den Charakter einer „Fernsehsendung“ hätte. Die neurobio- logische Forschung erweckt mitunter den Eindruck, als ob man hier die elektromagnetischen Impulse auf den Platinen eines Fernsehers mit dem Fernsehprogramm gleichsetzt. Oder etwas präziser: Der Fernseher wird nicht nur als technische Plattform für die Informati- onsverarbeitung betrachtet sondern auch gleichzeitig als Produzent des gesamten TV-Programms. Warum macht es aus Ihrer Sicht Sinn, hier genauer zu differenzieren?
Prof. Günter Ewald:
Der Fernseher – erweitert durch ein Studio – führt nur die Produktion technisch aus und produziert nicht selbst. Das geschieht „von außen“ durch Menschen. Naturalistische (oder materialistische) Hirn- biologie versucht, den gestalterischen „Geist“ in einen Automatismus des technischen Systems Gehirn selbst hineinzuverlagern, ein Auto- matismus, der sich durch technische Lernprozesse im Laufe der Evolution aufgeschaukelt hat. Das ist eine Pauschalbehauptung, die nicht bewiesen ist und auch als Hypothese grundlegende Fragen ausblendet: Wie sind die Bedingungen zu einem so fantastischen Prozess zustandegekommen? Reichen die bekannten Evolutionsme- chanismen für seine Erklärung aus? Ist dieses „Denksystem“ mögli- cherweise eine so grobe Vereinfachung, dass es kaum mehr zum Verständnis von „Geist“ leistet als die Kenntnis des menschlichen Skeletts zur Gesamtfunktion des Körpers? Kann man Quantenpro- zesse und paranormale Phänomene aus einem Verständnis von Geist und Seele eliminieren?
psychophysik.com:
Jetzt gibt es u.a. die Vorstellung, dass sich Bewusstsein und Geist im Verlaufe der Evolution Schritt für Schritt entwickelt haben. Zu Beginn waren da ein paar Einzeller im Wasser. Später bildeten sich komplexere Organismen, die auch über ein Gehirn verfügten. Und irgendwann kam dann angeblich das „Selbstbewusstsein“ hinzu, d.h. die Fähigkeit, sich selbst bewusst wahrnehmen zu können. Nachteil dieses Erklärungsansatzes ist das Problem, dass man den Sprung der Dimension ignoriert. Bei einem physischen Organismus auf der einen Seite und bei Bewusstsein auf der anderen Seite handelt es sich ja um vollkommen unterschiedliche Dimensionen. Ich persönlich sehe keine logische und plausible Erklärung dafür, warum eine Entwicklung in der Dimension A (vom Einzeller hin zum Menschen) kausal zur Entstehung einer vollkommen neuen Dimension B (Bewusstsein, Wahrnehmung etc.) beitragen soll. Ebensowenig, wie sich Wasser (Dimension A) auch nicht aus einer besonders großen Ansammlung von Zeit (Dimension B) bilden kann. Vom Physiker Jean E. Charon stammt daher der Ansatz, dass bereits der Einzeller, ja sogar das einzelne Atom, in irgendeiner Form über die Dimension B (Bewusst- sein, Geist) verfügt. Wie sehen Sie diese These?
Prof. Günter Ewald:
Schon Ernst Häckel tendierte mit seinen „Moneren“ in die Charon- Richtung. Ich finde diese aus verschiedenen Gründen nicht über- zeugend. Zum einen sehe ich nicht, wie man den Begriff „bewusst“, der aus der Psychologie stammt und immer auf „unbewusst“ bezogen ist, auf Einzeller oder Atome übertragen will. Mir erscheint das schon begrifflich absurd. Ferner ist die Vorstellung, dass sich Mini-Geister zu einem großen Geist zusammensetzen, mysteriös. Hier möchte ich die klassische Biologie in ihrer nüchternen Denkweise unterstützen, die den Übergang von wenig komplexen zu komplexeren Strukturen, so gut es geht, mit Hilfe physikalisch-chemischer Gesetze unter- sucht, ergänzt allerdings durch die nach dem englischen Paläontolo- gen Conway Morris („Life’s Solution. Inevitable Humans in a Lonely Universe“ 2003) unverzichtbaren finalen Strukturbeziehungen. Dann aber kommt man um die Frage nicht herum, die Sie mit „Dimension A“ und „Dimension B“ verbildlicht haben: Ist Bewusstsein, Selbstbe- wusstsein oder Geist nur komplexe materielle Stuktur, die, wie man- che Neurobiologen sagen, in der „1. Person-Perspektive“ als anders- artig erlebt wird, es aber in der (streng biologischen) „3. Person- Perspektive“ nicht ist? Oder begleitet die materielle Entwicklung nur als „Korrelat“ einen umfassenderen Prozess, bei dem etwas, das wir „Geist“ oder „Seele“ nennen, herauskommt, das schliesslich auch ohne den ursprünglichen materiellen Träger existieren kann und vorher schon auf diesen zurückwirkt? Auch wenn man diskutieren kann, welche Phänomene die eine oder die andere Entscheidung als plausibler erscheinen lassen, geht es um Überzeugung, nicht um wissenschaftliches Ergebnis. Lassen sich Geist und Seele wissenschaftlich erfassen?
psychophysik.com:
Sind Geist und Körper aus Ihrer Sicht getrennte Entitäten? Welche Möglichkeiten gibt es, diese Frage wissenschaftlich zu untersuchen?
Prof. Günter Ewald:
Statt „getrennt“ würde ich lieber „trennbar“ sagen. Der Geist steigt nicht in den Körper ein wie ein Fahrgast in ein Taxi, um nach einem Zweckaufenthalt wieder auszusteigen. Das wäre platonistisch gedacht und bedeutete eine besondere Form von Dualismus, die ich für „leibfeindlich“ und einem Gesamtbild des Menschen nicht angemessen erachte. Ich denke, im historisch einmaligen, mit dem sozialen Umfeld verwobenen Leib des Menschen wächst der Geist in einer Weise mit heran, dass ein „Kern“, den man traditionell „Seele“ nennen mag, im Tod bestehen bleibt, also erst dann sich vollständig vom Körper trennt. Hierbei benutzen wir die Begriffe „Geist“ und „Seele“ zunächst umgangssprachlich, ohne präzise Definition. – Eine wissenschaftliche Untersuchung ist sehr von der Art und Weise geprägt, wie man hilfsweise eine operationale Begriffsbildung versucht. Lässt man nur hirnbiologische Daten als definierende Merkmale zu, dann ist natürlich der Geist nicht vom Körper trennbar. Das liegt an der Begriffsbildung und ist kein wissenschaftliches Ergebnis. Lässt man einen größeren Erfahrungshorizont zu, der möglicherweise nicht neurobiologisch erfassbare Phänomene enthält, liegt eine Trennbarkeitshypothese nahe. Quantenphysik mag bei der Erfassung solcher Phänomene helfen; wahrscheinlich werden wir aber nie voll ausreichende Methoden finden, um Geist und Seele wissenschaftlich zu erfassen.
psychophysik.com:
Verschiedene bis heute ungelöste Rätsel könnten in dieser Frage vielleicht zum Nach- und Umdenken anregen. Da gibt es z.B. den Phantomschmerz. Menschen fühlen den Schmerz einer amputierten Gliedmaße so, als ob das Bein oder der Arm noch an ihrem Körper wäre. Was jedoch nicht mehr der Fall ist. Oder: Ob ich einen Sonnenaufgang am Meer real sehe oder ihn mir mit geschlossenen Augen nur geistig vorstelle, die Gehirnaktivität ist sehr ähnlich. Prof. Harald Walach schreibt hierzu „… es ist extrem schwierig zu sagen, wie sich zentral, innerhalb des Gehirns die Wahrnehmung eines externen Phänomens von einer intern generierten Vorstellung unterscheiden lässt…“(Generalisierte Quantentheorie). Michael Talbot berichtet in seinem Buch „Das holografische Universum“ von einer Vielzahl weiterer in die gleiche Richtung gehender Rätsel. Und ganz zum Schluss berichtet beispielsweise der Herzspezialist Pim van Lommel in einer prospektiven Studie zur Nahtodesforschung, welche immerhin von der renommierten Medizinzeitschrift THE LANCET publiziert wurde, von Fällen, in welchen um ihr Leben kämpfende Menschen im Zustand der Bewusstlosigkeit allem Anschein nach doch noch feststellen konnten, wo ihr Gebiss abgelegt wurde, welches sie später vermissten. Es mangelt somit nicht an Indizien, welche dazu anregen können, neben dem Gehirn auch an anderer Stelle zu suchen. Oder?
Prof. Günter Ewald:
In der Tat. Besonderes Gewicht messe ich den Untersuchungen van Lommels bei. Sie stützen einen großen Kreis von Berichten über „außerkörperliche Erlebnisse“, die ähnliche Beobachtungen enthalten. In dem eingangs von Ihnen erwähnten ersten Buch von mir (Nahtod- erfahrungen – Hinweise auf ein Leben nach dem Tod?) finden Sie eine Anzahl von Beispielen dokumentiert; in einem Fall (Serwaty) wurde von Arzt und Krankenschwester eine Wahrnehmung im „Schwebezustand“ als objektiv, vom OP-Tisch aus nicht einsehbar bestätigt. Es gibt sogar Versuche des amerikanischen Anästhesisten und Hirnforschers Stuart Hameroff, der mit dem englischen Physiker Roger Penrose zusammenarbeitet, zur Erklärung der außerkörperli- chen Erfahrung mit Hilfe quantenphysikalischer Nichtlokalität beizu- tragen. Das halte ich zwar für problematisch, ist aber immerhin ein Indiz für neue Denkansätze. Auch der Briefwechsel 1932-1958 zwischen dem Physik-Nobelpreisträger Wolfgang Pauli und dem analytischen Psychologen Carl Gustav Jung über „Synchronizität“ in paranormalen Phänomenen und deren Bezug zu Archetypen erhält neue Aktualität.
Bewusste Wahrnehmung ohne ein aktives Gehirn?
psychophysik.com:
Verschiedene bis heute ungelöste Rätsel könnten in dieser Frage vielleicht zum Nach- und Umdenken anregen. Da gibt es z.B. den Phantomschmerz. Menschen fühlen den Schmerz einer amputierten Gliedmaße so, als ob das Bein oder der Arm noch an ihrem Körper wäre. Was jedoch nicht mehr der Fall ist. Oder: Ob ich einen Sonnenaufgang am Meer real sehe oder ihn mir mit geschlossenen Augen nur geistig vorstelle, die Gehirnaktivität ist sehr ähnlich. Prof. Harald Walach schreibt hierzu „… es ist extrem schwierig zu sagen, wie sich zentral, innerhalb des Gehirns die Wahrnehmung eines externen Phänomens von einer intern generierten Vorstellung unterscheiden lässt…“ (
psychophysik.com:
Wie bewerten Sie rund um die Nahtodesforschung kursierende Hin- weise, dass Menschen mit einem flachen EEG (Merkmal eines inakti- ven Gehirns) berichten, in diesem Zustand – d.h. vielleicht ohne das Instrumentarium des Körpers – Dinge gesehen zu haben? Van Lommel spricht von drei erfassten Fällen, in welchen ein flaches EEG vorlag.
Prof. Günter Ewald:
Ich sehe darin einen Hinweis auf die Richtigkeit der oben gennannten Trennbarkeitshypothese. Um hierbei einem veralteten Dualismus zu entgehen, ist es wichtig, die materielle Wirklichkeit erweitert und offen zu denken, ferner den Begriff „Geist“ nicht materialistisch zu verengen. Im Bild gesprochen: In unserer heutigen technischen Welt sind wir damit vertraut, dass man Information (Musik, Film) auf einen anderen Träger überspielen kann. Warum sollte unser „Ich“ nicht ständig hirnbiologische Information in eine umfassende „Wirkungsge- samtheit“ – nennen wir sie „Seele“ – „einspielen“ können, die auch bei flachem EEG „fortwirkt“? Im Nahtodgeschehen bleibt in begrenz- tem Umfang die „Überspielung“ von Wahrnehmung und später deren „rückwärtige Überspielung“ möglich, im Tode dann irgendwann nicht mehr. Naturwissenschaft geht von der Erfahrung aus; zu dieser gehören auch ungewöhnliche Ereignisse, die ungewöhnliche Hypo- thesen herausfordern.
psychophysik.com:
Ihre Antwort führt zu einer weiteren interessanten Frage: Die eta- blierte Gehirnforschung geht ja davon aus, dass jenes Konstrukt, welches wir sprachlich mit dem Wort „Bewusstsein“ umschreiben, auf irgendeine geheimnisvolle … bis heute leider nicht entschlüsselte Weise … von unserem Gehirn selbst konstruiert wird. Einmal ange- nommen, die Berichte von „Sehwahrnehmungen“ trotz Bewusstlo- sigkeit und flachem EEG (Stichwort: van Lommels Gebiss-Beispiel) erhärten sich im Verlaufe weiterer prospektiver Nahtodesstudien: Was spricht dagegen, im Rahmen von Forschungsarbeiten einmal der Frage nachzugehen, ob das Gehirn nicht vielleicht ein Empfänger von „Bewusstsein“ außerhalb seiner selbst ist?
Ist unser Gehirn vielleicht ein Empfänger von “Bewusstsein” außerhalb seiner selbst?
Prof. Günter Ewald:
Eigentlich nichts. Es gibt auch bereits Arbeiten zu diesem Thema, vor allem im angelsächsischen Bereich. In Deutschland haben wir das große „Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene (IGPP)“ in Freiburg (Breisgau). Dort arbeitet man, ausgehend von der klassischen Neurobiologie, vorsichtig an Erweiterungen unserer Vor- stellungen von Bewusstsein, unter Einbeziehung von Chaostheorie und mit Anleihen bei der Quantenphysik, in einigen Ansätzen auch an „anomalen“, nicht klassisch neurobiologisch erklärbaren Fernübertra- gungen von Bewusstsein zu Bewusstsein. – Man sollte aber gleich hinzufügen, dass das Institut nur mit privaten Fördermitteln arbeitet. 1950 von Prof. Bender gegründet, sollte es ursprünglich hauptsäch- lich der Erforschung parapsychologischer Phänomene wie Telepathie, Hellsehen oder Psychokinese gewidmet sein. Davon ist wenig ge- blieben. Trotzdem gibt es am IGPP hoffnungsvolle Ansätze, die in den „main stream“ der staatlich geförderten Forschung eingebunden und erweitert werden sollten.
Quelle: psychophysik.com/
Nanotechnologie – Nanopartikel stören die Hirnentwicklung bei Mäusen
November 3, 2009
Japanische Forscher spritzten trächtigen Versuchstieren Nanopartikel. Die Nachkommen litten an neurologischen Störungen, die denen bei Alzheimer oder Autismus ähneln.
Quelle: zeit.de
Sensationeller Durchbruch – Hoffnung für Alzheimer-Patienten: 30 Jahre alte Erinnerungen wiedererweckt
Oktober 22, 2009
 Es klingt wie ein Science-Fiction-Gag: Wissenschaftler haben einen Weg gefunden, Erinnerungen wieder zu Leben zu erwecken. Mit Hilfe von Elektroden, die sie in das Gehirn eines 50 Jahre alten Patienten implantierten, haben sie seine erloschen geglaubten Erinnerungen wieder geweckt.
Es klingt wie ein Science-Fiction-Gag: Wissenschaftler haben einen Weg gefunden, Erinnerungen wieder zu Leben zu erwecken. Mit Hilfe von Elektroden, die sie in das Gehirn eines 50 Jahre alten Patienten implantierten, haben sie seine erloschen geglaubten Erinnerungen wieder geweckt.
Quelle: welt.de
Hirnforschung – Auf der Suche nach Gott im Gehirn
Oktober 21, 2009
 Tests mit Nonnen belegen: Religiöse Erfahrungen aktivieren verschiedene Hirnbereiche
Tests mit Nonnen belegen: Religiöse Erfahrungen aktivieren verschiedene Hirnbereiche
Nonnen denken bei religiösen Erfahrungen nicht nur mit einer für Gott reservierten Hirnregion: Ihr Gehirn ist in vielen Bereichen aktiv, die beispielsweise auch für Emotionen oder Körpergefühl wichtig sind. Das haben kanadische Forscher in einer Studie an 15 Nonnen herausgefunden. Während die Klosterfrauen eine Empfindung der Einheit mit Gott durchlebten, untersuchten die Wissenschaftler ihre Gehirnaktivität mit der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRI), mit der die Aktivität einzelner Hirnregionen bildlich erfasst werden kann.
Quelle: wissenschaft.de
Medizin – Pflichtbewusstsein schützt das Gehirn
Oktober 21, 2009
 Nonnen und Mönche erkranken seltener an Alzheimer
Nonnen und Mönche erkranken seltener an Alzheimer
Sehr pflichtbewusste und gewissenhafte Menschen haben ein geringeres Alzheimerrisiko. Das schließen amerikanische Forscher um Robert Wilson von der Rush-Universität in Chicago aus einer Studie mit tausend älteren Nonnen und Mönchen. Die genaue Ursache für das geringere Demenzrisiko ist unklar. Wahrscheinlich trainieren die Nonnen und Mönche durch ihr gewissenhaftes Arbeiten bestimmte Gehirnareale, die Demenzerscheinungen kompensieren können, vermuten die Wissenschaftler.
Quelle: wissenschaft.de
Neurologie – Wundersame Heilung des Gehirns
Oktober 21, 2009
 Das Gehirn ist viel wandelbarer als gedacht: Kinder ohne Großhirn lernen inzwischen sogar sehen, hören, krabbeln. Ein Jugendlicher mit nur einem halben Gehirn absolviert gerade sein Hauptstudium. Neue Therapien könnten auch Schlaganfallpatienten und psychisch Kranken helfen.
Das Gehirn ist viel wandelbarer als gedacht: Kinder ohne Großhirn lernen inzwischen sogar sehen, hören, krabbeln. Ein Jugendlicher mit nur einem halben Gehirn absolviert gerade sein Hauptstudium. Neue Therapien könnten auch Schlaganfallpatienten und psychisch Kranken helfen.
Quelle: welt.de
Selbstheilungskräfte – Wie das Gehirn uns Heilen kann
Oktober 16, 2009
 Der Krebsforscher B.J. Kennedy von der Medical School der Universität Minnesota hat 22 Menschen untersucht, die Krebs im fortgeschrittenen Stadium hatten, aber die Krankheit völlig überwanden. Das gemeinsame Merkmal dieser Patienten war, dass sie sofort nach der Diagnose, daran glaubten, die „Ausnahme von der Regel“ sein zu können. Sie weigerten sich, ihr Todesurteil zu akzeptieren und stürzten sich stattdessen engagiert und voller Hoffnung in die Therapien.
Der Krebsforscher B.J. Kennedy von der Medical School der Universität Minnesota hat 22 Menschen untersucht, die Krebs im fortgeschrittenen Stadium hatten, aber die Krankheit völlig überwanden. Das gemeinsame Merkmal dieser Patienten war, dass sie sofort nach der Diagnose, daran glaubten, die „Ausnahme von der Regel“ sein zu können. Sie weigerten sich, ihr Todesurteil zu akzeptieren und stürzten sich stattdessen engagiert und voller Hoffnung in die Therapien.
Gesunde Hirne schrumpfen nicht
Oktober 16, 2009
 Das menschliche Gehirn wird mit dem Alter nicht automatisch kleiner. Diesen Schluss legt eine Untersuchung niederländischer Neurowissenschaftler nahe. Solange sich weder Morbus Alzheimer noch andere Demenzerkrankungen einstellen, scheint das Volumen der grauen Hirnsubstanz über die Jahre konstant zu bleiben.
Das menschliche Gehirn wird mit dem Alter nicht automatisch kleiner. Diesen Schluss legt eine Untersuchung niederländischer Neurowissenschaftler nahe. Solange sich weder Morbus Alzheimer noch andere Demenzerkrankungen einstellen, scheint das Volumen der grauen Hirnsubstanz über die Jahre konstant zu bleiben.
Schlafforschung – Lärmprüfung im Gehirn
Oktober 15, 2009
Störende Geräusche bereiten oft Schwierigkeiten beim Einschlafen. Doch sobald man vom Schlaf übermannt wird, scheint das Gehirn sie zu ignorieren. Münchner Forscher haben jetzt mit Hilfe der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT) und der Elektroenzephalographie (EEG) herausgefunden, dass die Hörrinde im Gehirn beim Schlafenden selbst durch unerwartete Geräusche nicht aktiviert wird. Aber spezielle Wellen im EEG zeigen, dass das Gehirn trotzdem auf Gefahren reagieren kann.
Selbstheilung im Denkorgan
Oktober 14, 2009
 Das Gehirn ist formbarer als gedacht. Selbst Jahrzehnte nach einem Schlaganfall können Nervenzellen umlernen und neue Strukturen hervorbringen: Lähmungen schwinden, das Sprachvermögen kehrt zurück. Nun sollen bessere Therapien auch Kriegsveteranen und Seelenkranken helfen.
Das Gehirn ist formbarer als gedacht. Selbst Jahrzehnte nach einem Schlaganfall können Nervenzellen umlernen und neue Strukturen hervorbringen: Lähmungen schwinden, das Sprachvermögen kehrt zurück. Nun sollen bessere Therapien auch Kriegsveteranen und Seelenkranken helfen.
